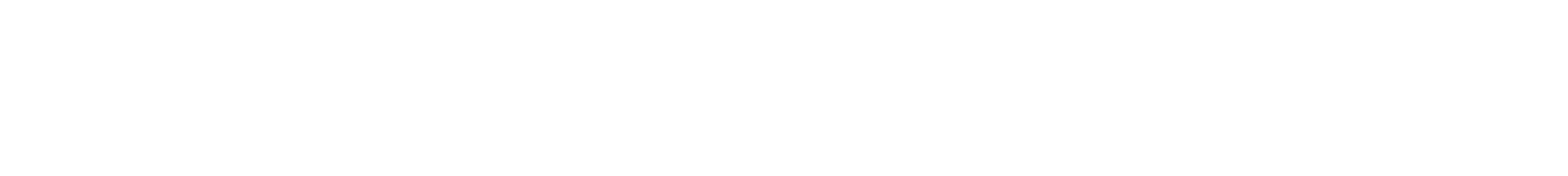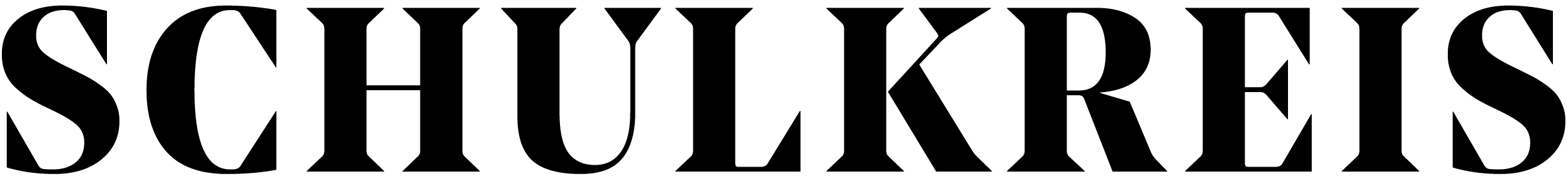Am 22. Januar fand ein Webinar (1) zu der Frage statt, wie es Schulen gelingt, Schülerinnen und Schüler mit psychischen Problemen in Regelklassen zu integrieren. Teilnehmende waren Schulleitungen, Lehrpersonen und Schulsozialarbeitende, vor allem aus Privatschulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 420 Anmeldungen zeigten, dass das Thema in den Schulen angekommen ist.
2024 waren in der Schweiz 6051 Jugendliche psychiatrisch hospitalisiert – fast 2000 mehr als vor zehn Jahren. Besonders betroffen sind junge Frauen. An Stadtzürcher Sekundarschulen weisen fast 30 Prozent von ihnen Anzeichen für Angststörungen oder Depressionen auf. Diese Auffälligkeiten haben sich in den letzten zehn Jahren nahezu verdoppelt.
Zahlen steigen seit 10 bis 15 Jahren
Inzwischen liegt eine Reihe von Studien dazu vor. Für Jörg Fegert, Referent des Webinars und Präsident der European Society for Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP), hat die mentale Gesundheitskrise junger Menschen bereits vor 10 bis 15 Jahren begonnen. Corona-Pandemie und nachfolgende Krisen wie der Krieg in der Ukraine haben sie lediglich verstärkt. (2)
Inzwischen ist auch klar: Die Effekte der Pandemie auf die psychische Gesundheit sind umso höher, je strenger die pandemiebedingten Restriktionen und Schulschliessungen in einem Land waren. Besonders stark betrafen sie Schülerinnen und Schülern, die sich in einem Stufenwechsel befanden, beispielsweise vom Kindergarten zur Primarschule oder von der Primarschule in die Sekundarschule.
Risiko für Depressionen ums Siebenfache erhöht
Während der Corona-Pandemie hat die Internetnutzung massiv zugenommen. (3) Das war notwendig, um soziale Kontakte aufrechtzuerhalten, hat aber zu Pathologien geführt. So zeigte sich, dass bei Mädchen die Lebenszufriedenheit zwischen 11 und 12 Jahren stark abzusinken beginnt, was mit deren zunehmendem Social-Media-Konsum zusammenhängt. Bei Jungen tritt dieser Effekt erst zwischen 13,5 und 15 Jahren auf. Erkannt ist auch, dass mit zunehmender Bildschirmzeit psychische Belastungen wie Depressionen, Angstzustände und Schlafprobleme signifikant ansteigen. Insbesondere Jugendliche, die mehr als acht Stunden täglich digitale Medien konsumieren, weisen ein fast siebenfach erhöhtes Risiko für Depressionen auf. (3)
Doch nicht alle Jugendlichen reagieren gleich auf den Medienkonsum. Viele zeigen ein «Low-Risk-Profil», bei dem der Medienkonsum kaum psychische Folgen hat. Bei anderen steigen sie massiv, speziell wenn psychische Vorbelastungen oder Traumata vorhanden sind. (4)
Mobbing an Schulen: Schweiz ist Europameisterin
In der Pisa-Studie 2018 (5) war die Schweiz das europäische Land mit den meisten Mobbingfällen unter Schülerinnen und Schülern. (6) Während 2015 etwa elf Prozent der Jugendlichen angaben, regelmässig gemobbt zu werden, stieg dieser Anteil 2018 auf 13 Prozent.
Auch körperliche Übergriffe nahmen zu. 2018 berichteten sieben Prozent der Schülerinnen und Schüler, mindestens ein paar Mal pro Monat geschlagen oder geschubst worden zu sein – mehr als doppelt so viele wie 2015. Besonders besorgniserregend ist der Anstieg von Bedrohungssituationen, die 2018 sieben Prozent der Schülerinnen und Schüler betrafen, verglichen mit nur drei Prozent drei Jahre zuvor.

Warum Jugendliche gestresst sind
Eine Studie von Pro Juventute (7) aus dem Jahr 2021 zeigt, dass ein Drittel der Kinder und Jugendlichen in der Schweiz unter hohem Stress leidet und diese Zahl bei den über 14-Jährigen auf 45 Prozent ansteigt. Besonders betroffen sind auch hier junge Frauen. Hauptursachen für Stress sind schulischer Leistungsdruck, Prüfungen, Mobbing und Zukunftsängste. Gleichzeitig zeigt die Studie, dass Zeit mit Freunden, Hobbys und Mitbestimmung zu Hause den Stress reduzieren kann.
Schule als Safe Space
Angesichts wachsender psychischer Belastungen könnten gerade Schulen ein Ort sein, an dem sich Kinder und Jugendliche geschützt und unterstützt fühlen. Besonders für jene aus schwierigen familiären Verhältnissen oder mit psychischen Problemen kann die Schule ein stabilisierender Faktor sein, der sie ihrem Milieu zeitweise entzieht, soziale Teilhabe ermöglicht und frühzeitig Hilfsangebote bereitstellt.
Heute fordern Schulen Jugendliche fachlich und sozial enorm heraus und verursachen – siehe oben – oft selbst Belastungen. Schülerinnen und Schüler mit psychischen Problemen müssen zusätzlich ihre Erkrankung bzw. Emotionen bewältigen. Das überfordert schnell.
Wichtig ist deshalb, dass Schulen psychische Gesundheitsfaktoren in den schulischen Alltag integrieren und eine Umgebung schaffen, die seelische Gesundheit fördert.
Psychische Gesundheit in den Schulalltag integrieren
Zu diesen Faktoren gehören: eine Mental Health Literacy, wonach Lehrpersonen und Klassen über grundlegende Kompetenzen hinsichtlich psychischer Gesundheit verfügen; Methoden zur Stressbewältigung und Selbstregulation, die Lehrplan und Unterricht vermitteln; eine besser koordinierte Prüfungskultur, die Leistungsdruck reduziert, individuelle Fortschritte stärker berücksichtigt oder – zumindest zeitweise – auf individuelle Lernziele setzt; eine professionelle Kooperation mit Psychiatrie und Elternhäusern, wenn Jugendliche in einer Krise sind oder aus einer Klinikschule in ihre Regelklasse zurückkehren; Notfallpläne für akute Krisen, insbesondere für Suizidalität oder Selbstverletzungen.
In England gibt es bereits Organisationen wie Trauma-informed Schools UK (TISUK), die Schulen in kleinen, unspektakulären Schritten unterstützen, eine Kultur mentaler Gesundheit zu etablieren. Im Kern nennt TISUK vier Faktoren: körperlichen Schutz und Förderung psychischer Gesundheit (Protect); Sicherstellung des täglichen Zugangs zu einem emotional verfügbaren Erwachsenen (Relate); Reduzierung von Stress durch positive Interaktionen (Regulate); Förderung einer empathischen und reflektierenden Kommunikation (Reflect). Im Erfolgsfall erhalten Schulen dafür das Label «Trauma and Mental Health Informed Schools». (8)
Grenzen schulischer Verantwortung
Schulen sind jedoch keine Ersatztherapiezentren. Akute psychiatrische Krisen, etwa schwere Depressionen mit Suizidalität oder substanzabhängige Jugendliche, erfordern professionelle medizinische und therapeutische Hilfe. Hier besteht ihre Aufgabe darin, frühzeitig zu erkennen, wann externe Fachkräfte oder Institutionen einzuschalten sind.
Inzwischen haben sich Schulen – bei allen Schwierigkeiten – auf Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten, ADHS oder Autismus eingestellt. Spätestens seit der Corona-Pandemie rückt die wachsende Zahl von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Problemen ins Bewusstsein. Sie fordern Schulen heraus, Kompetenzen im Bereich mentaler Gesundheit zu erwerben, die nicht nur den Betroffenen, sondern letztlich allen nutzen.
- Fegert, J. M., & Sitarski, S. (2024): Eine globale Krise junger Menschen (10–25 Jahre). Ein Kommentar aus deutscher Sicht zum Bericht der Lancet Psychiatry Commission on Youth Mental Health, in Zeitschrift für Kindschaftsrecht und Jugendhilfe, Nr. 12/2024, S. 419–423
- https://www.dak.de/dak/unternehmen/reporte-forschung/studie-mediensucht-2021_12624
- https://www.researchgate.net/publication/349901005_Mental_Health_in_Adolescents_during_COVID-19-Related_Social_Distancing_and_Home-Schooling
- https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/jora.13045
- https://www.pisa-schweiz.ch/wp-content/uploads/2021/09/PISA2018_SuSinCHimInternationalVergleich_deu.pdf
- https://www.blick.ch/schweiz/pisa-vergleich-mit-europa-deckt-traurigen-missstand-auf-schweizer-schulkinder-werden-am-meisten-gemobbt-id15647175.html
- www.projuventute.ch/de/stress-studie
- www.traumainformedschools.co.uk