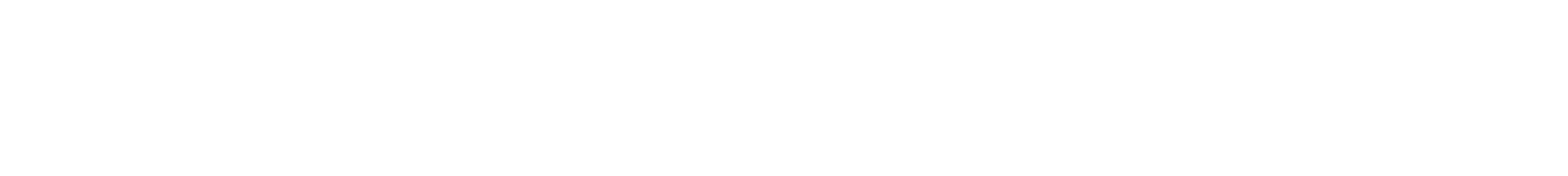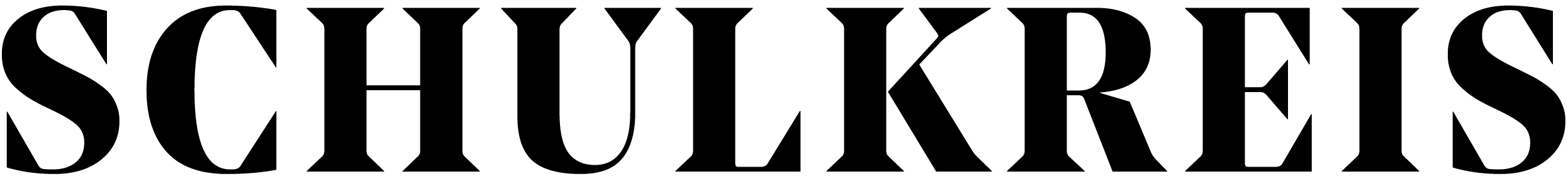Sonnenschein. Wärme und Licht wie an den ersten Frühlingstagen. Ich sitze auf einer Bank und beob- achte die Passanten. Meistens Paare unterschiedlichen Alters. Vielleicht nehme ich nur die Paare mehr wahr. Einige scheinen mir junge Paare zu sein, einander zu- gewandt, in ihrem gemeinsamen Einklang, der ihre Liebe bestätigt, wiederholt und steigert. Den älteren Paaren gelingt das weniger. Gehen stumpf, gemein- sam durch die Landschaft. Manche schimpfen mitei- nander über irgendetwas. Ich sehe wenige Paare, die sich ihre Frische, Neugier und Lebendigkeit bewahrt haben. Dazwischen sehe ich alle möglichen Schattie- rungen lebendigen oder erloschenen Zusammenseins. Ich glaube, dass es eher zu den schwierigen Aufgaben gehört, sich innerhalb einer Beziehung zu verändern. Es scheint einfacher zu sein, sich zu trennen und sich woanders neu zu finden. Oder abzustumpfen, jede Ver- änderung abzulehnen und sich mit kleinen Kompro- missen zu arrangieren – bis am Ende alles nur noch ein Kompromiss ist, dessen Ursprung man kaum noch nachvollziehen kann.
Und natürlich denke ich, dass es nur das Bild einzel- ner Menschen ist, das an mir vorbeizieht. Vielleicht interpretiere ich zu viel hinein. Aber es scheint mir ein Problem zu sein, mit dem sich Gemeinschaftsformen heute herumschlagen, und das meist in der Organi- sation endloser Kompromisse endet. Eine Anhäufung von ungelösten Ablagerungen, die die Bewegungsfrei- heit und Lebendigkeit erheblich einschränken.
Jetzt höre ich innerlich den Zuruf meines Redakteurs aus dem Schulkreis. Es soll ja kein «philosophisches Traktat» werden, sondern ein prägnant sprechendes Bild bleiben.
Recht hat er. Es ist ja auch eine Kolumne – eine Art persönliche Meinung, die unterhaltsam mitgeteilt wird. Und da frage ich mich schon, wie ich das jetzt machen soll.
Mich würde nämlich jetzt interessieren, warum es so ist, dass Formen der Selbstaktualisierung – also Up- dates – nur am Computer einfach sind. Im wirklichen Leben erweisen sie sich als ziemlich kompliziert und sind in Gemeinschaften kaum möglich. Hier stehen die Steinerschulen nicht allein, sondern teilen das Schicksal einer Gesellschaft, die sich schwer tut, ei- nen angemessenen Umgang mit Zeitfragen zu finden. Angst vor Veränderung oder die Macht der Gewohn- heit treffen nicht den Kern der Sache. Es ist die tiefere Frage nach dem Selbst, dem ungeborenen Selbst. Dem Selbst, das noch werden will. Zu diesem Selbst wäre in einem zweiten Schritt das ICH in Beziehung zu setzen. Ein ICH, das heute seine Aufgabe missversteht und sich deshalb mit seinem Selbstbestimmungsaktionis- mus im Sumpf der Kompromisse verliert. Dabei hat das ICH die Aufgabe, mit viel Mut den Klang des Selbst zu hören. Und diesem Klang Raum zu geben, indem es mit dem Einfach-weiter-So aufhört.
Abschliessend könnte man das Ganze mit einem Zitat von Beuys, passend zur Frühjahrsausgabe, mit dem Auferstehungsgeschehen in Verbindung bringen. Und ja, dann hätte ich doch die zu vermeidende «philoso- phische Abhandlung» geschrieben.
Zu vermeiden, nicht weil eine Kolumne einen anderen Anspruch hat, sondern weil es nichts bringt. Worte haben in diesem Bereich wenig Kraft. Es ist eine Frage des Mutes des Einzelnen und der Gemeinschaft, ent- schlossen zu sein. Entweder ich bemühe mich um Selbstaktualisierung oder ich lasse es. Und das gilt auch für Gemeinschaften.
10. April 1924, ein Freitag. Rudolf Steiner sitzt noch einmal mit den Absolventinnen und Absolventen der ersten 12. Klasse zusammen. Die Sonne scheint ins Zimmer. Man spricht über Berufswünsche. Eigentlich Zwiegespräche zwischen Rudolf Steiner und den ein- zelnen 17 Jugendlichen. Dann sagt Rudolf Steiner in die Runde: «Im Leben, das euch erwartet, wird euch die Erinnerung an die Schule begleiten, und wenn ihr in einem Augenblick steht, wo ihr keinen Rat findet und nicht mehr ein noch aus wisst und ihr seid sinnend und hilfesuchend für euch alleine, da wird der Geist der Schule hinter euch treten, euch seine Hand auf die Schulter legen und euch Rat und Trost spenden.»1
Ich denke, hier ist, jenseits aller Menschenkunde und aller didaktischen Methoden, der Kern der Waldorf- schule ausgesprochen. Und dieser Kern ist der Mut mit sich selber und seiner Beziehung zur Welt radikal Ernst zu machen. Es geht darum, den Mut aufzubrin- gen, sich selbst und die Beziehung zur Welt aufrichtig und konsequent zu gestalten – sowohl auf persönli- cher Ebene als auch im Kollegium. Dies geschieht in und durch die Begegnung mit dem Anderen.
Simone Weil beschreibt diesen Prozess des Ernstmachens als Gegengewicht zur Schwerkraft.
«Erkenne, dass der Mut durch dich die Erde hebt».
1 Tomáš Zdrazil: Waldorfpädagogik, Verlag am Goetheanum, Dornach 2021