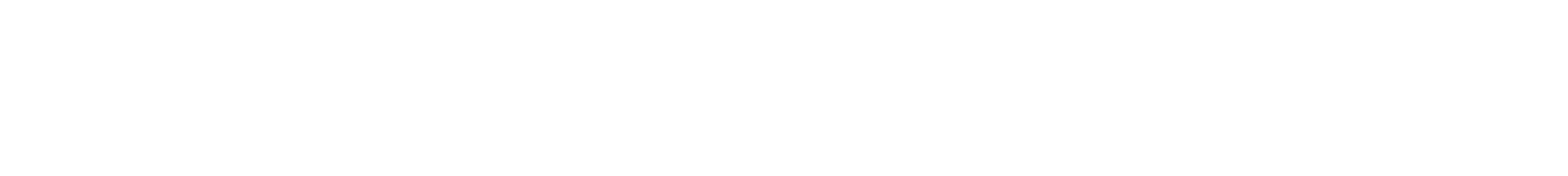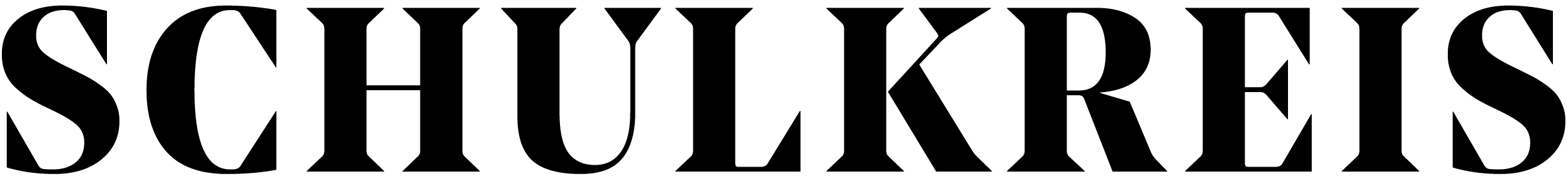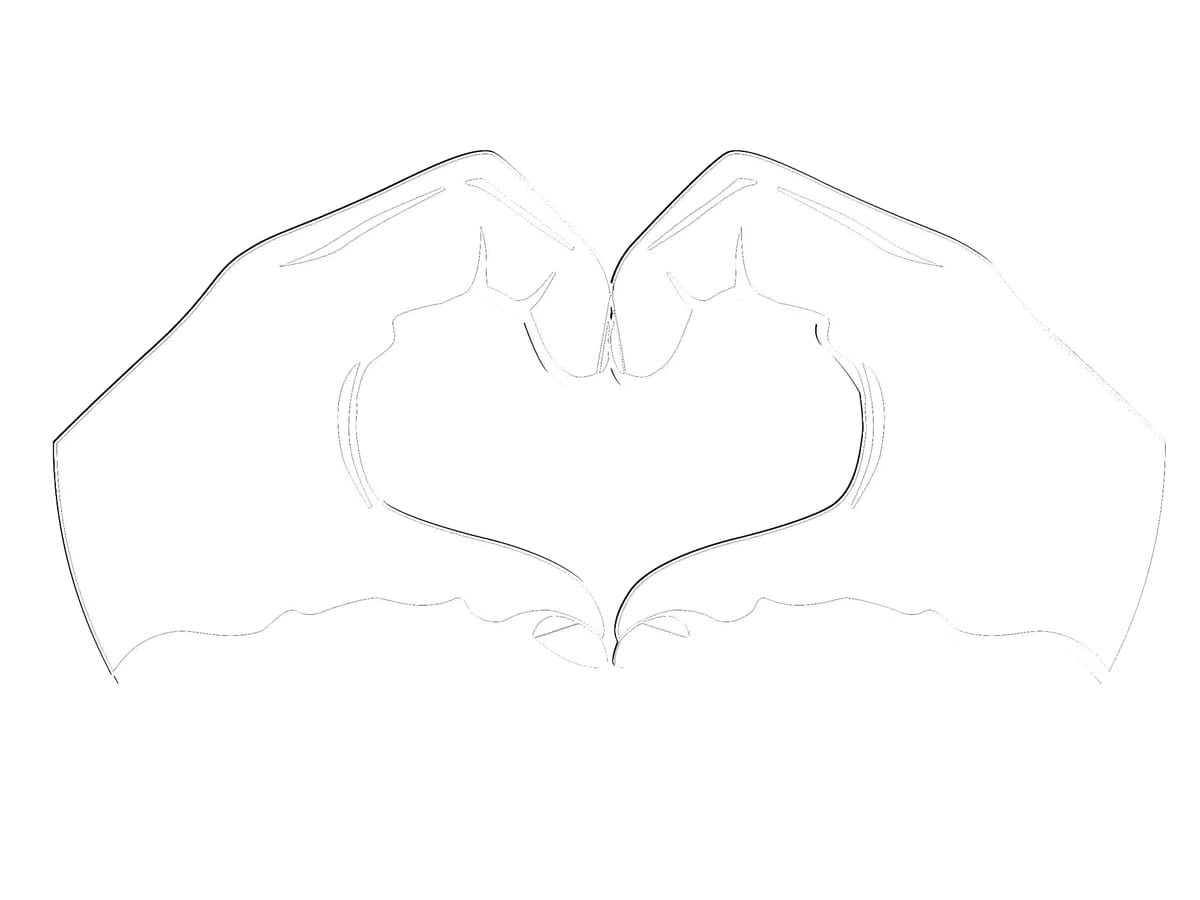Roswitha Ialá-Kutzli war über 20 Jahre, Heinz Brodbeck über zehn Jahre im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft der Rudolf Steiner Schulen in der Schweiz (ARGE) tätig; beide wurden Ende 2024 verabschiedet. Roswitha Ialá-Kutzli verbrachte ihre Kindheit in der Rudolf Steiner-Heimschule «Montolieu» am Genfersee, eine Schule, die ihre Eltern 1951 gegründet und viele Jahre geleitet hatten. Sie studierte Sozialpädagogik in Hamburg und Waldorfpädagogik und Eurythmie in Dornach. An der Steinerschule Birseck arbeitete sie als Eurythmie- und Klassenlehrerin und unterrichtete in den Fächern Französisch, Orchester und Religion. Seit ihrer Pensionierung ist sie an verschiedenen Steinerschulen als Mentorin für neue Lehrkräfte tätig sowie als Dozentin für Methodik-Didaktik und in der Studienleitung am Waldorflehrer-Seminar in Freiburg/Breisgau.
Heinz Brodbeck war seit der Einschulung seiner vier Kinder ehrenamtlich in der Rudolf Steiner Schulbewegung tätig. Seine «Steinerschulkarriere» startete als Schulvater, Stuhlträger, Bühnenarbeiter bis zum vieljährigen Präsidenten des Schulvereins der Rudolf Steiner Schule Adliswil, Vorstand der Atelierschule und als Stiftungsrat. Seine berufliche Tätigkeit begann er als gelernter Bankkaufmann, er studierte Betriebsökonomie und arbeitete in Führungspositionen eines globalen Energiekonzerns.
Welches waren Ihre grössten Erfolge während Ihrer Vorstandtätigkeit bei der ARGE?
Heinz Brodbeck: Es gibt ja nicht «meine Erfolge», sondern nur das Bemühen, mit seinem besten Einsatz zum Gedeihen der Sache beizutragen. Manchmal nahm ich «die Fahne in die Hand» und durfte vorausgehen. Ich verstand meine Aktivitäten aber immer als Miteinander. Es erübrigt sich deshalb, hier Einzelheiten aufzuführen. Robert Thomas ist als Präsident der ARGE sehr motivierend, er sorgte dafür, dass Erfolge uns nicht selbstzufrieden machten und wir Niederlagen gelassen analysieren und daraus lernen konnten. Seine Geduld hätte ich manchmal gerne gehabt.
Roswitha Ialá-Kutzli: Auch mir ging es nicht um Einzelerfolge, sondern um die Gemeinschaft der Schulen, die «Schulbewegung» und die qualitativ gute Zusammenarbeit. Jedes Treffen der Arbeitsgemeinschaft fand an einem anderen Standort statt, so lernten wir im Laufe der Jahre alle Schulen und ihre besonderen Stärken und Schwächen ein wenig kennen. Diese wahrzunehmen und gemeinsam an der Weiterentwicklung der Pädagogik zu arbeiten, gelang uns mit mehr oder weniger Erfolg.
Was schreiben Sie mit Ihrem Abschied der ARGE ins «Hausaufgabenheft»?
HB: Zuerst danke ich dafür, dass ich in der ARGE mitwirken durfte. Dasjenige, was ich mitinitiieren konnte und noch als gut befunden wird, soll der heutige Vorstand kraftvoll weiterführen. Zu wünschen wäre für die Arbeit der ARGE weniger Fokus auf das Finanzielle und das Reglementieren zugunsten einer ideellen Vertiefung, einer Öffnung und eines effektiven Austausches mit anderen pädagogischen Strömungen. Statuarischer Zweck der ARGE ist u.a., Schulen in schwierigen Situtionen zu helfen. Dazu wäre manchmal eine frühzeitigere Kooperation zwischen Schulen und ARGE nützlich. Unter Umständen kann es angezeigt sein, gemeinsam radikale Veränderungen auf den Weg zu bringen. Im Zentrum sollte deshalb die Frage stehen: Was will sich aus der Zukunft heraus in die Schulen «inkarnieren» . Oder pragmatischer gefragt: Was hat an unserer Schule seine Gültigkeit verloren, welche Wandlungen sind notwendig? Dabei mag anthroposophische Grundlagenarbeit in allen Schulen und Gremien helfen.
RIK: Aus der Arbeit im Klassenzimmer und der Schule immer wieder hinauszugehen in die Schulgemeinschaft der Schweiz und interessiert in die Weltschulbewegung zu schauen, war mir ein Herzensanliegen. Es hat wiederum meine Arbeit mit den Kindern geprägt. Ich wünsche der ARGE und allen meinen lieben Kolleginnen und Kollegen, dass sie weiterhin dieses ein- und ausatmende Wahrnehmen und Impulsieren pflegen. Dass sie die Waldorfpädagogik weiterentwickeln, aus ihrer Quelle Kraft schöpfen, immer mit dem Blick darauf, was die Kinder und Jugendlichen heute wirklich brauchen.
Warum, meinen Sie, gibt es in der Schweiz nicht hundert Steinerschulen?
HB: Zum Glück gibt’s nicht hundert. Schon für die 28 ist es eine grosse Herausforderung, den hohen Ansprüchen der Waldorfpädagogik immer gerecht zu werden. Ökonomisch gesprochen: Das heutige Angebot deckt gerade die Nachfrage, sonst gäbe es Gründungsinitiativen. In der Schweiz sind die staatlichen Schulen bestens ausgebaut und erfüllen ihren Auftrag. Davon zeugt das hohe, allgemeine Bildungsniveau im Land. Zudem gibt es eine grosse Anzahl von Privatschulen, die pädagogische «Mixturen» offerieren. So können sich Eltern heute quasi eine auf ihre Erwartungen und die vermeintlichen Bedürfnisse ihrer Kinder zugeschnittene Schule aussuchen. Das Bildungswesen wandelt sich, die Steinerschulen bleiben stabil. Das ist Stärke und Schwäche zugleich. Aber es gibt mutmachende Lichtfunken an jeder Steinerschule, Menschen, die für sie brennen und sie weitergestalten.
RIK: Wir haben oft gerätselt, woran es liegt, dass nach dem Aufschwung der Steinerschulen die Schülerzahlen in den letzten Jahren stark zurückgegangen sind. Es gibt viele Antworten darauf. Wir haben in der ARGE und im Vorstand mit den Koordinatorinnen und Koordinatoren intensiv daran gearbeitet, Schulen in jeder Hinsicht, auch finanziell, zu stärken, und alles uns Mögliche zu tun, um sie in der Öffentlichkeit «auffindbar» zu machen. Zum Beispiel mit jährlichen, schweizweiten «Tage der offenen Tür».

Was verbindet Sie mit den Steinerschulen persönlich? Warum haben Sie ihre Kinder auf diese Schulen geschickt bzw. dort gearbeitet?
HB: Kurz vor meiner Heirat hat mich Anthroposophie berührt. Die Schulentscheidung hat später meine Frau gefällt, da war ich wenig gefragt, bin aber froh darüber, ausser, dass es mein Konto gehörig geleert hat. Andere flogen in teure Ferienresorts, wir gingen nach Spanien zelten. Das waren aber jeweils herrliche, spartanische zwei Sommerwochen. Für die Steinerschule zu sparen lohnt sich.
RIK: Es ist einerseits ein biographisches Motiv: Ich war mit meiner eigenen Schulzeit sehr zufrieden, habe dort viele Impulse bekommen, besonders in der Oberstufe. Meine beiden Kinder dorthin mitzunehmen, war für mich selbstverständlich. Andererseits wurde mein Berufswunsch davon geprägt, dass ich mit Menschen zu tun haben wollte, nicht mit Bürotischen. Ich wollte in einer Gemeinschaft tätig sein und vor allem wollte ich zu den Kindern.
Die ARGE wurde im Vergleich zum Bund der Freien Waldorfschulen in Deutschland relativ spät begründet. Woran liegt es, dass die Steinerschulen in der Schweiz – wie Robert Thomas und Heinz Zimmermann in ihrem Buch «Die Rudolf Steiner Schulen in der Schweiz» andeuten –, stärker auf ihre Autonomie bedacht zu sein scheinen als die Waldorfschulen in Deutschland?
HB: Ich weiss nicht, ob das so ist. In Deutschland decken die staatlichen Zuschüsse an die Waldorfschulen etwa 70 Prozent der Kosten. Der Staat regelt dort stärker mit als hier. Vielleicht war ein Verband zur Interessenvertretung in der Schweiz nicht vordringlich. Es bildete sich aber eine Oberstufenzusammenkunft für den losen Erfahrungsaustauch der Schulen untereinander. Bis daraus ein Verein in Form der heutigen ARGE entstand, dauerte es. Die Schulen wollten keine Einmischung von aussen. Heute fördert die ARGE die Kooperation unter den Schulen und die Öffnung nach allen Seiten. Sie führt Projekte, wie z. B. Lehrpläne und Lehrerweiterbildungsprogramme. Es ist an den Schulen zu sagen, was sie von der ARGE wollen. Obwohl die ARGE die Autonomie der Schulen verteidigt und keine Weisungsrechte hat, spiegelt sie die Leistungen der Schulen kritisch-konstruktiv. Dazu besuchen die Koordinationsstelle und die Vorstandsmitglieder jede Schule von Zeit zu Zeit.
RIK: Schwierige Frage. Einen der Gründe sehe ich darin, dass die drei «Ur-Steinerschulen» Basel, Zürich, Bern, die lange Zeit die einzigen waren, sehr geprägt wurden von ihren Gründerpersönlichkeiten und den jeweiligen Umständen. Jede der Schulen bekam dadurch eine ganz eigene «Persönlichkeit» und grenzte sich auch von den anderen ab. Später lockerte sich das auf, aber es blieb als Motiv bestehen.
Sie haben bisher ihre gesamte Biographie lang in der «Waldorf-Luft» verbracht. Was hat sie dazu gebracht, dieser Bewegung treu zu bleiben?
RIK: Indem Sie mich das fragen, wird mir bewusst, dass ich mir diese Frage nie gestellt habe. Das heisst nicht, dass es im Laufe der 35 Jahre nebst Höhen nicht auch Tiefen gab, wo ich an mir, aber nicht an der Aufgabe zweifelte. Treue ist für mich durch alle Widerstände hindurch nicht aufzugeben, weil man das Urbild der Sache oder des Menschen kennt, auch wenn es sich im Alltag manchmal verdunkelt.
Ausserdem gibt es in meiner Biographie eine kurze Zeitspanne, wo ich «ausgebrochen» bin, aber diese war entscheidend für mich. Während der Studien- und Praxisjahre in Hamburg, kam ich unvorbereitet in die Studenten-Bewegung. Vieles habe ich aufgenommen, geprüft, verworfen, nächtelang diskutiert. Was will ich? Da hat mich auch das Denken und Handeln von Persönlichkeiten geprägt wie zum Beispiel Dag Hammarskjöld, Martin Luther-King, Mikis Theodorakis, Ernesto Cardenal, der heilige Revolutionär. Dann kam der Moment, wo ich die Anthroposophie prüfen wollte, und das führte mich nach Dornach zu unseren sehr geschätzten Lehrern Jörgen Smit, Heinz Zimmermann, Lea van der Pals und anderen. Dann war der Weg klar.
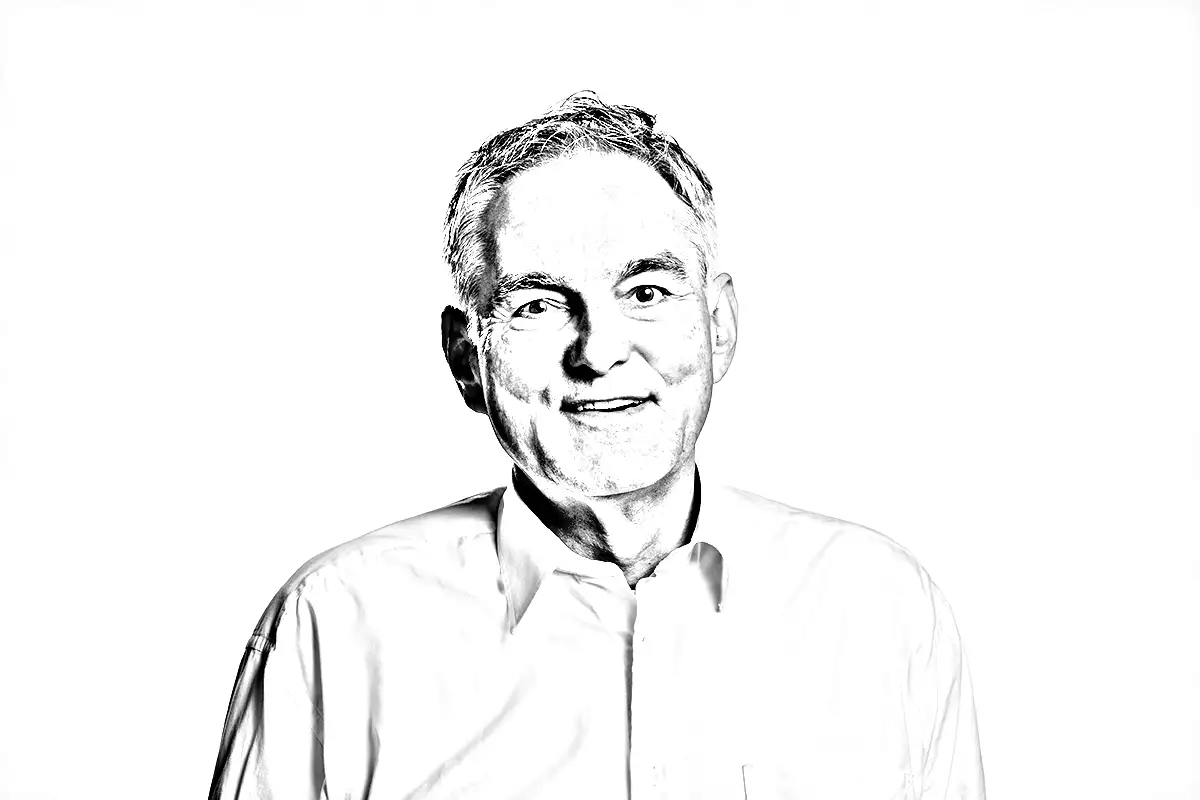
Ihr bekanntestes Buch, ist «Rudolf Steiner Schule im Elterntest«. Haben die Schulen den Test bestanden?
HB: Ja, durchaus. Aber die Eltern empfinden ein Entwicklungsdefizit. Es ist paradox: Die Steinerschuleltern sind mit den Schulen grundsätzlich gut zufrieden, die Absolventen und Absolventinnen geben der Schule mehrheitlich auch gute Noten. Studien zeigen, dass auch Eltern an staatlichen Schulen für die Erziehung und Schulung ihrer Kinder genau das wünschen, was die Waldorfpädagogik verspricht, und trotzdem geht die Gesamtzahl der Steinerschüler und -schülerinnen hier seit Jahren zurück. Lehrerbildung inklusive anthroposophische Kompetenz; vertrauensvolle, professionelle Interaktion mit Eltern und Aussenwelt sowie Reformen in der Selbstverwaltung scheinen aus Sicht von Forschungen wichtige Aktionsfelder.
In Ihrem «Unruhestand» sind Sie immer noch in der Lehrerbildung tätig. Was treibt Sie an?
RIK: Ich hatte in der Schule öfters erlebt, dass neue Lehrkräfte aus Zeitmangel nicht gut eingearbeitet werden konnten. Das beschäftigte mich. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Thomas Stöckli, in dem wir ein Mentorats-Wesen entwarfen und dann mit Einbezug verschiedener Menschen und natürlich der AfaP (Akademie für anthroposophische Pädagogik – Ausbildungsstätte für zukünftige Steinerschullehrpersonen) auf den Weg brachten. Das wurde auch ein wichtiges Thema in der ARGE: die Einarbeitung der neuen Lehrkräfte in die Schulpraxis. Ich habe in vielen Schulklassen der Schweiz hospitiert und dann partnerschaftlich auf Augenhöhe mit den Lehrkräften ihre und meine Fragen besprochen. Die Methodik-Kurse mit den Studierenden der Lehrerausbildung machen mir immer noch Freude.
Sie haben erst im Pensionsalter promoviert. Normalerweise steht dies am Anfang einer beruflichen Karriere. Was hat sie dazu motiviert?
HB: Zwei meiner Kinder sind promovierte Ärzte, da dachte ich, es geht nicht an, dass der Vater kein Dr. vor dem Namen hat. Naja, ich bin ein Spätzünder und Eitelkeit spielt wohl auch mit (lacht). Trotzdem finde ich akademische Meriten fürs Menschsein völlig unbedeutend.
Was hat Sie neben der Fülle Ihrer ehrenamtlichen Aktivitäten zum Theaterspiel gebracht?
HB: Eine meiner Töchter. Sie spielt und singt seit langem in Amateurensembles. Das ganze Leben ist ja in mehrdeutigem Sinne ein Theater. Für mich lebt es sich auf der Bühne aber gefahrloser aus. Manchmal ist Theaterspielen auch Therapie. Und etwas Therapie hat doch heute jeder nötig! (lacht)
Was ist Ihnen an der Waldorfbewegung der wichtigste Impuls?
RIK: Wie soll ich das in wenigen Worten sagen? Für mich ist es die Kunst der Erziehung, der Beziehung, der Entwicklung. Die Künste selber natürlich, aber das Entscheidende ist für mich die künstlerische Methodik. «Das Was bedenke, mehr bedenke Wie!», sagt Goethe.
Schule ist für mich viel mehr geworden als nur ein Ort zum Lernen, obwohl ich das Gesamtkunstwerk des Waldorf-Lehrplans unglaublich reich finde und mit Begeisterung all die vielen Themen mit den Schülerinnen und Schülern erarbeitet habe.
Den ganzen Unterricht in Methode und Aufbau künstlerisch zu gestalten bedeutet: Wie lasse ich ein inneres Bild, einen Gedanken, einen Begriff im Kind, Schüler und Schülerin, entstehen? Wie lasse ich im Unterrichtsablauf das eine in das andere übergehen? Wie spreche ich jedes Kind an? Wie nehme ich wahr, was heute das Kind mitbringt und was es braucht? Und was tue ich dann? Wie kann ich dem Kinde und Jugendlichen zu helfen versuchen, die Idee, die als das eigene Wesen mitgebracht wird, in die Erscheinung treten zu lassen? Pädagogik ist eine soziale Kunst. «Man sieht nur mit dem Herzen gut!» (Antoine de Saint-Exupéry)
HB: Wow, das hast Du schön gesagt, Roswitha. Auch in den Diskussionen an den Sitzungen hast Du immer wieder mal eine fundamentale Perspektive eingenommen. Das war dann gewissermassen wie eine Zäsur in der Debatte und hat Tiefe gebracht. So konnte sich Ideelles an Realem reiben. Ich glaube, die Verschiedenartigkeit und Herkunft der Mitglieder des Vorstandes hat ihn stark gemacht. Wir sahen uns immer als dienende Initiatoren, Unterstützer und als Sparringpartner der Koordinationsstelle, die ja täglich helfend für die Schulen tätig ist.
Lieben Sie das Risiko? – Mit über 70 Jahren haben Sie sich noch aufs Pferd gesetzt.
HB: Nicht wirklich, die Angstbremse greift eher schnell. In einer Reithalle steht von Goethe geschrieben: «Wenn ihr’s nicht fühlt, ihr werdet’s nicht erjagen.» Das ist sehr sinnig fürs Reiten. Man lenkt das Pferd übers Gefühl. Gelingt so die Symbiose mit dem Pferd, kann man einen magischen Moment erleben. Ich sehe die wirklichen Reitmeister mehr als Künstler denn als Sportler. Übrigens war mein Grossvater Bauer, ein bisschen Stallgeruch liegt in mir.