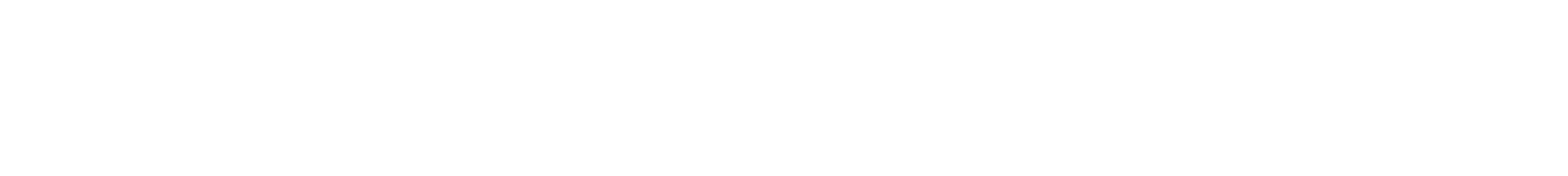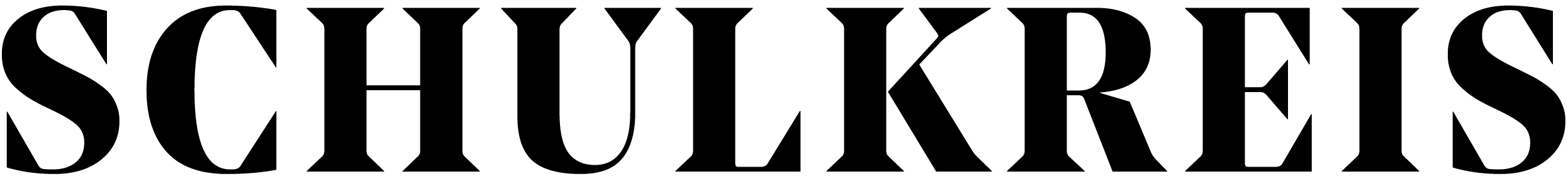Motivation für das Studium der Waldorfpädagogik
Was hat Sie motiviert, Waldorflehrer werden zu wollen und Waldorfpädagogik zu studieren?
Die Waldorfpädagogik basiert auf den menschenkundlichen Erläuterungen Rudolf Steiners. Sie waren die ersten Quellen, die meinem Interesse am Menschen genug Nahrung gaben. Gleichzeitig lassen sie mich frei und zwingen mich zu nichts. Sie fördern und fordern mein eigenes Forschen, Hinschauen, Nachspüren und Weiterentwickeln in dem Masse heraus, wie es meinem eigenen Anspruch ans Lehrerdasein entspricht.
Vereinbarkeit von Ausbildung und Familie
Wie gestaltet sich der Spagat zwischen Elternsein, Studium und der Praxis in der Schule?
Nachdem ich eine volle Stelle als Lehrperson angenommen hatte, wurde mir klar, warum an manchen Orten von den sogegannten «Waldorfwitwen» gesprochen wird. Die Vorbereitungszeit, das Verwalterische und das Organisatorische nehmen einen grossen Teil meiner Zeit in Anspruch, den ich nicht an der Schule selbst verbringe. Ich muss mir jeden Tag sagen: Pauca sed matura – lieber weniger, dafür konzentriert und ausführlich. Das führt mitunter zu viel weniger, als die Norm der heutigen Zeit vorsieht, wobei in dieser Norm doch sehr viele mit grossem Stress leben. Zu reduzieren und zu bremsen erfordert grossen Mut und Kraft.
Ist die praxisbegleitete, duale Ausbildung eine Hilfe?
Ja, sehr. Alle vier Wochen einen «Ausstieg» aus dem Schulgeschehen zu erleben, und dabei sehr intensiv an Schulthemen, auch grundsätzlicher Art, zu arbeiten, ist eine sehr wertvolle Kraft- und Inspirationsquelle meiner Arbeitstätigkeit. Ich will mir überlegen, was an die Stelle der Ausbildung kommt, wenn ich sie abgeschlossen habe. Ich möchte auch, dass andere Menschen sich regelmässig Zeit dafür nehmen, ihre Arbeit an der Steinerschule zu reflektieren und innerlich zu vertiefen – nicht nur alleine, sondern auch in Gemeinschaft.
Wie organisieren Sie Ihren Alltag, um den Anforderungen des Studiums, der Arbeit in der Schule und den Aufgaben als Elternteil gerecht zu werden?
Ich schaffe möglichst viele Routinen und Rituale, damit der Rhythmus Kraft gibt.
Haben Sie das Gefühl, dass die zeitliche Belastung machbar ist, oder gab es Momente, in denen Sie an Ihre Grenzen gestoßen sind?
Es gab und gibt immer noch Zeiten, an denen die Belastung gross ist. Ich habe allerdings in den letzten Jahren gelernt, mir diese Belastung auch vom Leib zu schaffen, in dem ich Dinge absage und einfach nicht alles das mache, was von mir erwartet wird. Ich halte inzwischen viele Erwartungen für eingebildet, ausgedacht und destruktiv. Ich suche seit den ersten grossen Belastungsphasen sehr intensiv nach dem Kern, aus dem heraus ich die Sachen tue. Stehen die Entscheidungen in mir auf sicherem Grund, bekomme ich Kraft, sie zu erfüllen. Kommen die Entscheidungen und Formen zu sehr von aussen, muss ich zu viel übernehmen, kostet es mehr Kraft als ich habe. Ich sage dann ab oder ergreife und ändere die Sache so, dass sie ganz meine wird.
Praxis und Schule
Haben sie im Rahmen der praxisbegleitenden Ausbildung schon konkrete Aufgaben an der Schule übernommen?
Ja, ich bin Klassenlehrer geworden, vertrete die Schule im Kreis anthroposophischer Initiativen in der Region und bereitete eine Stufenklausur für das Lehrpersonal vor.
Wie empfinden Sie die Zusammenarbeit mit den Lehrkräften und dem Kollegium der Schule? Fühlen Sie sich gut mentoriert und unterstützt?
Ich fühle mich an der Schule sehr gut unterstützt und mentoriert, habe aber auch Veränderungsideen. Die betreffen vor allem die Fürsorge der Lehrpersonen. Ich sehe es als die zentrale Aufgabe an, bei der Arbeit bei Kräften zu bleiben – gesund zu bleiben. Steiner betonte immer wieder, um wie viel bedeutender es sei, wie die Lehrperson sei, im Gegensatz zu dem, was sie tue. Dafür, denke ich, muss bald, wie in anderen sozialen Berufen auch, eine regelmässige Supervision für alle Lehrpersonen verpflichtend eingeführt werden. Nur so lässt sich die seelische Leistungsfähigkeit der Lehrpersonen wirklich aufrechterhalten. Ohne regelmässiges «Aussteigen aus der Alltagsarbeit» geht, meiner Beobachtung nach, zu viel unter, auch wenn oft beteuert wird, dass man auf alle acht gibt. Es findet nicht ausreichend statt. Um Missverständnissen vorzubeugen: Ich meine wirklich die klassische Supervision als eine Form der beruflichen Beratung, die zur Reflexion des eigenen Handelns anregt und die Qualität professioneller Arbeit sichern und verbessern soll. Dass sie psychotherapeutische Elemente enthält, und die Grenze zur Psychotherapie nur schwer zu ziehen ist, ist genau das, was ich meine. Die seelische Gesundheit der Lehrpersonen ist das A und O einer gesunden Schule.
Persönlicher Gewinn und Perspektiven
Was haben Sie persönlich durch den neuen Beruf, das Studium und die praktische Arbeit an der Schule gewonnen? Hat sich dadurch Ihre Sicht auf Bildung und Erziehung generell verändert?
Ja, ich habe erkannt, dass die Steinerschulen noch viel mehr Kraft aufbringen müssen, keine Schulen des Zeitgeistes zu sein. Die Steinerschulen müssen die Menschlichkeit wieder selbstbewusst ergreifen. Und der Zeitgeist ist das Gegenteil davon. Wenn die Steinerschulbewegung es nicht schafft, sich hinzustellen, ein Ort der Menschlichkeit zu sein, sondern sich um Anpassung bemüht, wird sie bedeutungslos. Ich ergänze noch: Die Schule darf sich nicht anpassen – aber sehr wohl um Anschluss bemühen.
Name des/der Interviewten: Axel Stirn
Alter: 43
Kinder (wie alt): 21, 19, 5
Angaben zur Klasse/Anzahl SuS/Stufe: 9 SuS,
Mehrstufenklasse, Klassenstufen 5 bis 8 m