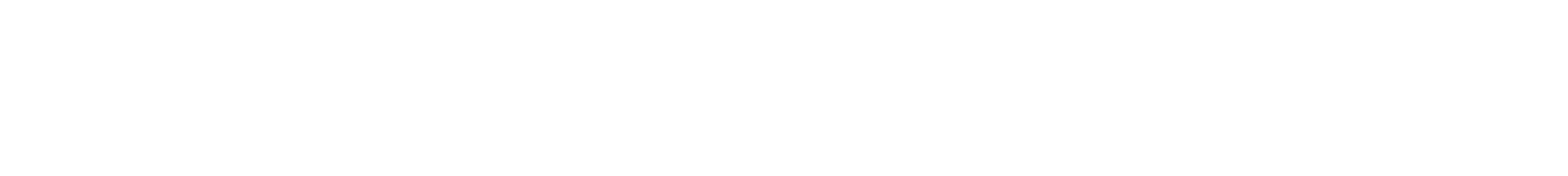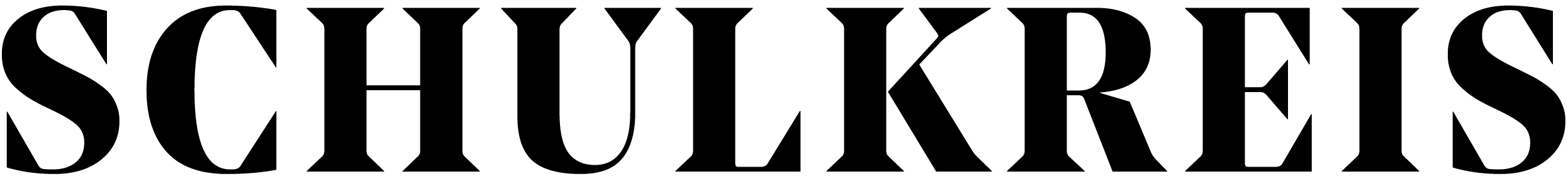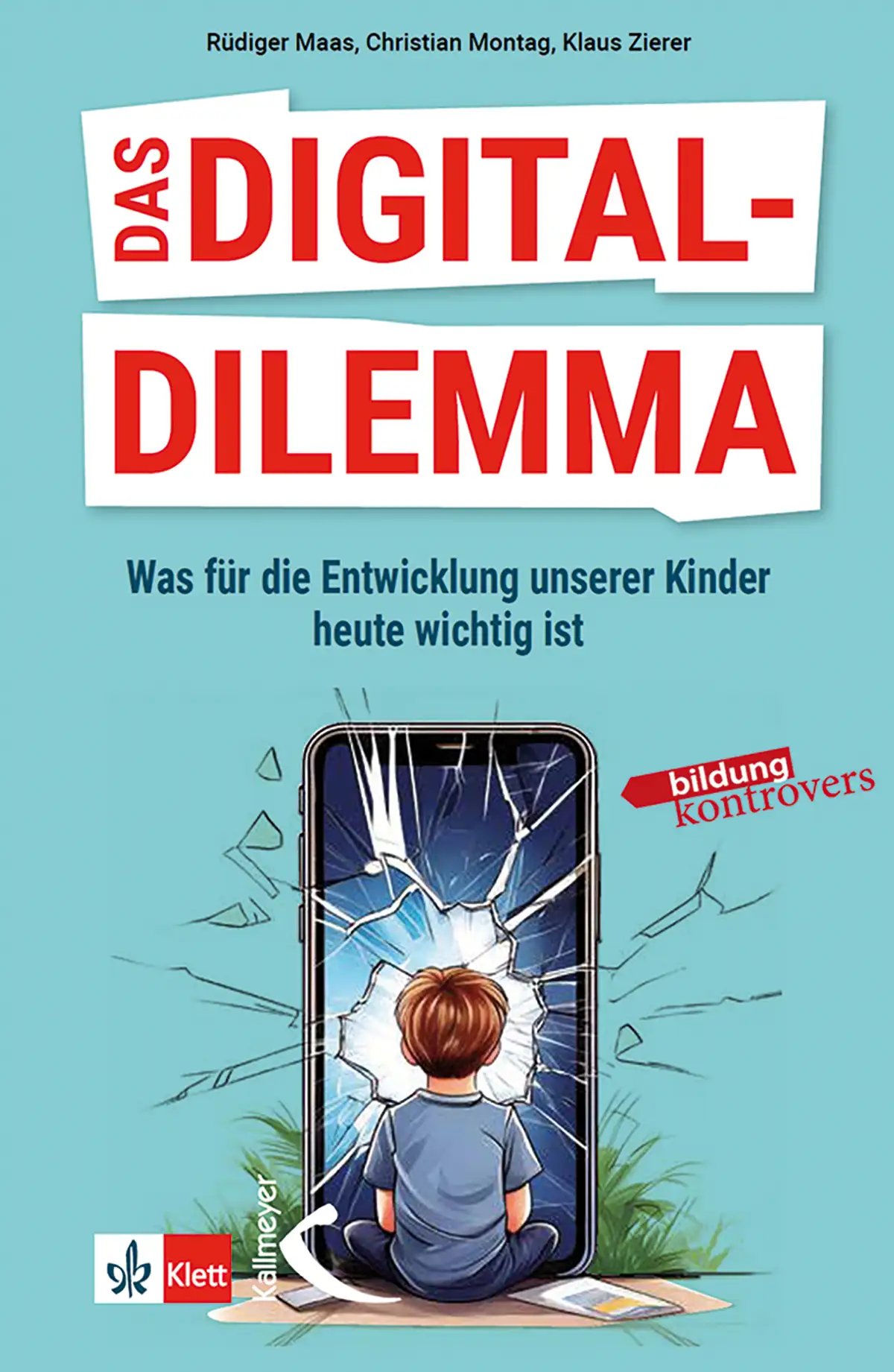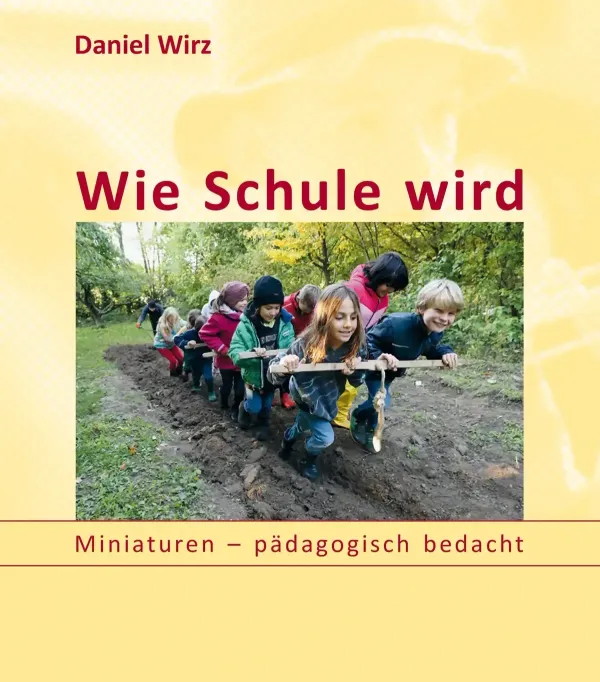Schwimmen im Wald
Gleich drei namhafte Autoren widmen sich einem brennenden Problem : Was kann man der Omnipräsenz der digitalen Welt entgegenstellen, um eine gesunde Entwicklung von Heranwachsenden nicht nachhaltig zu gefährden ? Denn es ist nicht ausgemacht, ob das soziale Wohlbefinden der Kinder und Jugendlichen mit zunehmender Social-Media-Nutzung steigt – im Gegenteil. Also welches Maß zwischen digitalem Detox und digitalem Dauerfeuer das richtige ist, wird stark vom Alter des Nutzers und seiner (Selbst-)Kontrollfähigkeit abhängen. Fakt ist : Die Zahl der durchschnittlichen Online-Stunden pro Woche liegt bei über 70 Stunden, das heißt bei rund 10 Stunden pro Tag. Tendenz steigend.Die Autoren geben neben vielen Hinweisen auf aktuelle Studien durchaus auch persönliche und anschaulich begründete Ratschläge zur Herstellung eines ausgewogenen Umgangs mit digitalen Devices. Leider ist den neun kurzen Beiträgen nicht zu entnehmen, wer von den dreien ihn verfasst hat. Aber es fängt schon mal gut an : Mit einem Songtext von Neil Young wird in eine neue Sportart eingeführt : Schwimmen im Wald. Da der Mensch nicht dafür gemacht sei, sich ausschließlich in digitalen Räumen aufzuhalten, müsse er sich wieder verstärkt der Natur zuwenden und sich in ihr bewegen, am besten mit Waldbaden. « Grüne » Spaziergänge führen nachweislich zu einer Steigerung des emotionalen Wohlbefindens und kognitiver Leistungsfähigkeit. Das ist eine Binsenweisheit, aber schön, dass die Empirie sie neu bestätigt. Viel spannender ist die Frage : Werden diese Erfahrungen und Erkenntnisse, abgesehen von der privaten Lebensführung, konsequent in der Schule (oder auch am Arbeitsplatz) umgesetzt ? Ein erstes Umdenken findet statt : Mehr spielerisches Lernen, Unterrichtsbeginn mit Spiel, raus in die Natur, denn je grüner die Umgebung, desto aufmerksamer die Kinder und desto besser ihr Arbeitsgedächtnis im Vergleich zu den Stubenhockern. Nicht zuletzt wird durch den urbanen Lebensstil die Stress-Resilienz deutlich gemindert. Es muss nicht gleich eine Waldschule sein, schon ein « grünes Klassenzimmer » kann Wunder wirken und die « innere Alarmanlage » nach unten regulieren. Und bei Studierenden haben zehn- bis neunzigminütige « Naturinterventionen » positive Leistungseffekte erbracht. Fazit : « Natur zu erleben, ist gesund für den menschlichen Geist. »Wie das Spiel wieder zur bildungswirksamsten Tätigkeit werden kann, darauf geht der zweite Beitrag « Mit perfektem Spielzeug in die Spielkrise » ein. Damit Spielen bildungswirksam werden kann, muss es zweckfrei sein. Am besten es braucht gar kein Spielzeug, und wenn, dann wenig, ohne Technik und Elektronik. Kommen Computer-Spiele dazu, dann müssten unbedingt Regeln und Zeiten eingehalten werden. Schließlich das Wichtigste für die Schule : Edutainment, also Erziehung und Unterhaltung, das würde nicht funktionieren, da die digitale Ablenkung von den Lerninhalten die Aufmerksamkeit abzieht.
Im nächsten Beitrag geht es um die Frage « Wie digital kann Lernen sein ? » Dazu wieder der erste Fakt, den jeder sofort unterschreiben kann : Smartphones lenken ab, und zwar je näher sie liegen, desto mehr. Zweiter Fakt : Es ist nicht egal, ob auf dem Laptop oder auf dem Papier geschrieben wird. Denn man hat herausgefunden, dass beim Lernen, bei der Informationsverarbeitung und bei der Wissensaneignung die Verstehenstiefe handschreibend angeeignet größer ist als mit dem Tablet. Zwar erledigen Chatbots mit Zauberhand in Nullkommanichts die Hausaufgaben, die im Ergebnis kaum vom « Original » zu unterscheiden sind – aber sie nehmen das Denken ab und darauf kommt es ja beim Lernen an. Ohne den Willen zum Denken findet kein Lernen statt, auch wenn das digital generierte Ergebnis beeindrucken mag.Mit « Reichweite, Likes, Sternchen – Digitale Kommunikation bewältigen » folgen Beispiele, wie Kommunikation und ihre digitalen Kanäle als Machtmittel und Desinformationsinstrument gezielt zum Einsatz kommen. Dass die Präsidentschaftswahl in Rumänien deshalb wiederholt werden muss, ist ein aktuelles Beispiel. Studien ergaben, dass sich Botschaften algorithmusgesteuert um so viraler verbreiten, desto emotionaler die Botschaften sind. Während im digitalen Kommunikationsraum nur noch der kommerzialisierbare Daumen-hoch-Like gilt, verarmt die um Differenziertheit und Elaboriertheit bemühte Sprache in der analogen Welt zunehmend. Hier sollte Schule eine « analoge Gegenposition », einen « analogen Ruheraum » bieten, um konstruktive und differenzierte Feedbacks einzuüben. Denn auch hier gilt : Zuerst muss die Sprache beherrscht werden, um sinnvoll mit Chatbots umgehen zu können.
Es folgt ein Beitrag zu digitalen Abhängigkeiten und Suchtgefahren durch Gaming und Social Media. Abhängig gilt als jemand, der nicht mehr aus eigenen Kräften aufhören kann. Zu Gaming Disorder gehören Kontrollverlust, Priorisierung von digitalen und Verlust von realen sozialen Kontakten. Während die WHO die Computerspielabhängigkeit bereits als Erkrankung eingestuft hat, ist dies bei Social Media noch nicht geschehen, selbst wenn die User durchschnittlich zehn Stunden am Tag online sind. Die sozialen Netzwerke sind so gebaut, dass sie die Aufmerksamkeit der Nutzenden immer stärker bannen. Für viele Schülerinnen und Schüler bedeutet dies, dass die Schulleistungen immer schlechter werden und sie sich immer schlechter fühlen. Wenn überhaupt bekommen die Erwachsenen viel zu spät mit, was ihr Nachwuchs auf den Plattformen gelesen und gesehen hat.
Empfehlungen, ab welchem Alter Jugendliche Zugang zu sozialen Medien erhalten sollten, gehen oft auf überholte Nutzungsdaten zurück (z. B. in den USA auf das Jahr 2000, worauf man sich auf ein Mindestalter von 13 Jahren einigte).
Unter der Überschrift « Digitales Dating – Liebe und Freundschaften im digitalen Raum » wird eingangs auf die genuin menschliche Fähigkeit zur Beziehungsbildung eingegangen. Diese wird zunehmend von technischen Mitteln ersetzt. Dating-Plattformen werden von rund 400 Millionen Menschen genutzt und begründen reale Partnerschaften, auch wenn der Kuppler ein Algorithmus ist und seine « Beweggründe », Profile zu « matchen », unbekannt sind. In der realen Welt sind Beziehungen jedoch kontextabhängig entstanden und folgen nicht den digitalen Profilen, deren Leitmerkmal das « erotische Kapital » darstellt. Zudem läuft unsere Kommunikation zu großen Teilen über nicht verschriftliche oder verbalisierte Signale. – Psychologen konstatieren, dass Dating-App-Nutzende eher unter mangelnden Selbstwertgefühlen, Angst, Depressionen und Einsamkeit leiden. Hervorgehoben wird schließlich, dass das, was mich « einzigartig macht, mich nämlich ohne fremde Hilfe, selbstständig und dabei aus freiem Willen bewegen zu können », technisch gesteuert wird.
Auch die Berufswelt wird von der digitalen Entwicklung erfasst, davon handelt der Beitrag « Wenn die einzige Konstante der Wandel ist : Vom Traumberuf zum Arbeitsmarkt ». Darin wird anschaulich geschildert, welche neuen Berufe die jungen Menschen heute – wie zum Beispiel Gamer, Streamer, E-Sportler oder Influencer – besonders attraktiv finden. Welche Berufe einmal en voque sein werden, können weder Eltern noch die Wissenschaft abschätzen. Sicher ist, die KI wird die Berufswelt in all jenen Bereichen umkrempeln, die repetitiv sind – von der Rechtsprechung bis zur Radiologie –, außer den sozialen Berufen, die im Gegenzug einer gesellschaftlichen und finanziellen Aufwertung und Anerkennung bedürfte. Die KI ist gut und schnell im Kombinieren, aber nicht in der Schöpfung von wirklich Neuem, in der Reaktion auf Unvorgesehenes oder individuell Adäquates. Lineare Berufswege gehören der Vergangenheit an und damit wird Planbarkeit und Sicherheit obsolet. Entscheidend wird deshalb sein, herauszufinden, für was man wirklich brennt – und dafür braucht es « Grit » (Leidenschaft und Ausdauer) und Resilienz. Allerdings führt die Omnipräsenz von Social Media genau zu dem gegenteiligen Effekt : Schnelle Belohnung und Defokussierung.
Der abschließende Beitrag mit dem Titel « Ein Plädoyer für eine digitale Schuluniform » beschäftigt sich mit der zentralen Rolle von Schule und Elternhaus, um Kinder und Jugendliche vor den digitalen Risiken zu bewahren. Klar ist : Die Aufrüstung der Schulen mit Hardware ist ein zu kurz gesprungener Reflex, auch wenn die Kinder nicht mehr draußen, sondern vor dem Bildschirm aufwachsen. Das beste Tablet hilft nicht, Zusammenhänge herzustellen, lesen und schreiben tatsächlich auch zu lernen oder seinen individuellen Stil zu finden. Das wird die Zukunftsaufgabe der Lehrkräfte sein : souveränen Umgang vermitteln, Fake und Desinformation zu erkennen sowie von seriösen Quellen zu unterschieden lernen. Und – das Wichtigste – dass die digitale Welt bei all ihrer Attraktivität, Bequemlichkeit und Erleichterung dem Grundbedürfnis – zumindest der Kinder – nach Bewegung und der Entdeckung der Welt mit allen Sinnen prinzipiell zuwiderläuft. Freie Kreativität und soziale Kompetenzen werden die Zukunftsfähigkeiten sein. Digitalisierung sollte an Schulen nur eingeführt werden, wenn sie zu einem nachweisbaren Vorteil gegenüber herkömmlichen Lernmethoden führten – und dieser Nachweis konnte bis heute nicht erbracht werden. Eine « digitale Schuluniform » wird gefordert, in die keine (privaten) Smartphones passen, aber alles dafür tut, die Schüler und Schülerinnen in Medienkunde, Mediennutzung, Mediengestaltung und Medienkritik zu unterrichten.
In mehreren Beiträgen wird die wichtige Rolle der Eltern beim Umgang mit Medien hervorgehoben und intensive Begleitung, Gespräche und Aushandlungen « auf Augenhöhe » empfohlen. Dem stehen zwei große Hinderungsgründe entgegen : 1. Die Eltern sind selbst kein gutes Vorbild und ständig unkontrolliert in ihrem Nutzungsverhalten online. 2. Eltern haben schlicht nicht die Möglichkeiten, um selbst die Anschaffung eines Gerätes zu verhindern, geschweige denn die Nutzungsdauer und die konsumierten Inhalte effektiv zu kontrollieren und noch dazu stundenlange Aushandlungsgespräche, die regelmäßig im Streit enden, mit ihren Kindern zu führen. Kurz : Sie sind überfordert. Und selbst wenn in der Schule pädagogisch sinnvolle Medien(schutz)konzepte Anwendung finden (Stichwort : Handyverbot) – in der Schule, zu Hause und in der Freizeit werden sie systematisch unterwandert – da kennt die Phantasie der Kinder und der Jugendlichen sowie die Ohnmacht oder selbsternannte Eigenexpertise in Sachen Medienkompetenz der Eltern keine Grenzen.
Rüdiger Maas, Christian Montag, Klaus Zierer : Das Digital-Dilemma. Was für die Entwicklung unserer Kinder heute wichtig ist. 116 S., brosch., EUR 19,95, Klett Kallmeyer, Hannover 2024