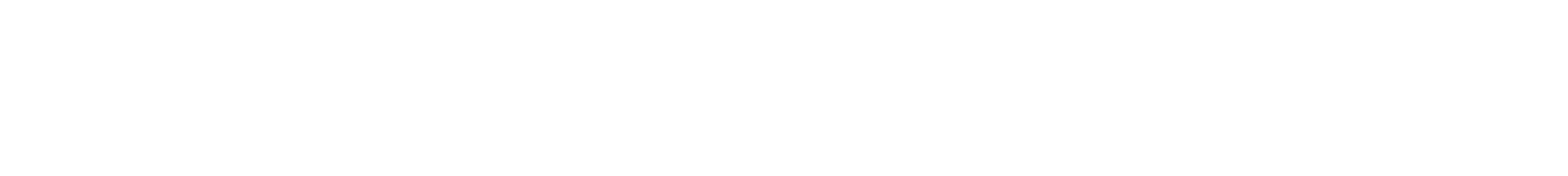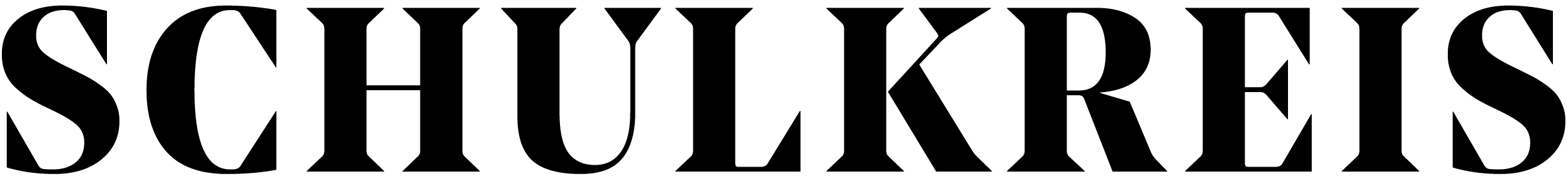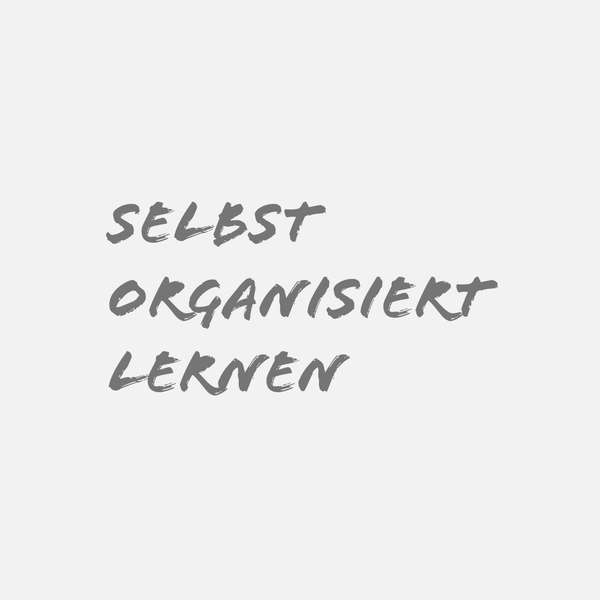Text: Angélina Bieler
Jeder Schüler, jede Schülerin kommt wöchentlich zur immer gleichen Zeit mit der immer gleichen Lehrperson im Wochengespräch zusammen. Die Jugendlichen können ihren Gesprächspartner wählen und es besteht die Möglichkeit zu wechseln, wenn sie es nicht als gewinnbringend erleben. In den Wochengesprächen besprechen die Jugendlichen auf Grundlage ihres Journals, das sie führen, was sie in welchem Fach erreichen wollen, wie sie ihre Woche und das Arbeiten planen und wie sie zurechtkommen.
In diesen Wochengesprächen macht sich schnell ein Raum zwischen zwei Polen auf. Zwischen ganz pragmatischen, konkreten Fragen (wann mache ich diese woche was?) und übergeordneten, meistens latenteren Fragen (wer bin ich? was will ich?), die etwas Wesentliches berühren: ihr Selbst und ihr Werden. Es entsteht eine Begegnung mit einem Freiraum, in dem die Jugendlichen am Alltäglichen, mehr oder weniger bewusst, auch tiefere Fragen anfangen zu bewegen. was will ich lernen? was will ich mich stellen? was macht mir mühe? wovon will ich mich befreien? Sie können dort sich selbst, eine Sache oder das Verhalten von Lehrpersonen infrage stellen und Verhältnisse entwickeln. Ohne Angst vor Auswirkungen in der Beurteilung, sondern im Vertrauen in die Beziehung. Ein wesentlicher Grund, weshalb die Wochengespräche solch eine echte Begegnung überhaupt ermöglichen, ist sicher unsere grundsätzlich veränderte Rolle durch das Abbauen von Fremdbestimmung und Notenbeurteilung, welche die Jugendlichen im sonst vorherrschenden Schulverhältnis permanent erfahren. Die Jugendlichen kommen im SOL ohne benotete Prüfungen in eine Autonomie, die etwas Dynamisches eröffnet und eine Entwicklung anregt. Den Rückblick auf das Geschehene in einen Blick auf Kommendes verwandeln, weil keine Leistung durch eine Note besiegelt wird, weil die Jugendlichen ihr Tempo des Vorankommens selbst bestimmen können und sie sich dem, was noch nicht klappt, weiter nachgehen können – wenn sie wollen. Dieses Prozesshafte wollen wir in den Wochengesprächen begleiten und als Haltung pflegen.
Das SOL hat zudem ein freilassendes Moment, in welchem die Jugendlichen ihrem Wollen gegenüberstehen, was sie im Unterricht sonst nicht oder kaum kennen. Im ersten halben Jahr SOL-Erfahrung, die die Jugendlichen machen, zeigt sich in den Wochengesprächen bei vielen eine Scheu, bei einigen eine Orientierungslosigkeit im eigenen Ausfüllen dieses freien Willensraums. Dort, wo sie nicht mehr im Vorgeschriebenen sind, kommen sie ins Sich-Ausrichten. Sie können erproben, was sie eigentlich wollen und was nicht, auf ganz neue Weise: nämlich in Resonanz mit sich selbst.
In diesem Raum, im Ausloten ihres Verhältnisses zum Stoff und zum Lernen, kommen kleinere und grössere übergeordnete Fragen auf, die innere Entwicklungsprozesse der Jugendlichen berühren. warum stolpern sie wo über sich selbst? was sind ihre handlungsmotive? in welches verhältnis wollen sie sich zu etwas, zu jemanden stellen? Diese Fragen berühren den Kern des Lernens.
Dieses Berühren findet in den Wochengesprächen in einer echten Begegnung Platz, wenn ich mich dem Wesen oder gar im Wesen der Jugendlichen öffne. Ich meine, dass sich in diesen Wochengesprächen unsere pädagogische Kernaufgabe der Beziehung stellt. Diese Aufgabe ist nicht nur auf mein Gegenüber gerichtet, sondern zuerst auf mich selbst. Die Qualität der Beziehung wird bestimmt durch meine Begegnungsfähigkeit, und ich muss daran ein Urinteresse haben. Und in dieser Begegnungsfähigkeit kann ich mich schulen. wer bin ich selbst? was kommt mir von meinem gegenüber entgegen? Es geht in den Wochengesprächen also um die Entwicklung der Jugendlichen und essentiell auch um die von uns Lehrpersonen selbst. Wir versuchen in den wöchentlichen Teamtreffen der im SOL eingebundenen Lehrpersonen und auch im Seminar der Atelierschule[1] in eine regelmässige, gelebte Auseinandersetzung und Übung zu pädagogischen Grundfragen zu kommen.
In diesen Prozessen liegt bei den Jugendlichen und uns Lehrpersonen das Lebendige, weil sich Verändernde und stetig Formende.
Zur Autorin: Angélina Bieler ist seit 2023 an der Atelierschule Zürich, hat eine Klassenleitung inne, unterrichtet Mathematik und Physik und entwickelt den Wandel zum Selbstorganisierten Lernen an der Atelierschule mit.
seminar.atelierschule.ch. Das Seminar Atelierschule versteht sich als Institution für Lehrpersonen (7.–13. Klasse), an der Grundlagen der Waldorfpädagogik kennengelernt, erarbeitet, vertieft, erforscht und weiterentwickelt werden. ↩︎