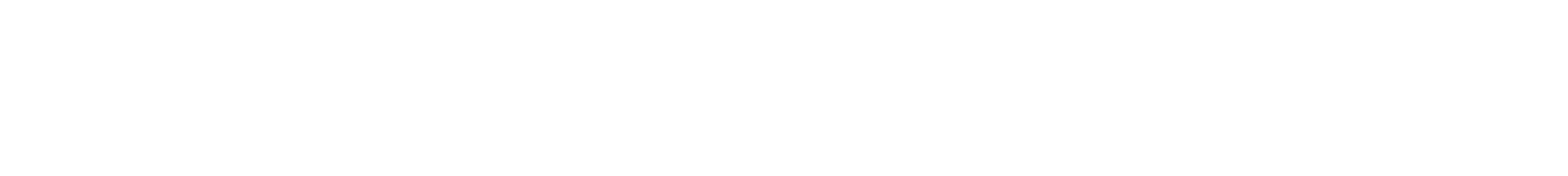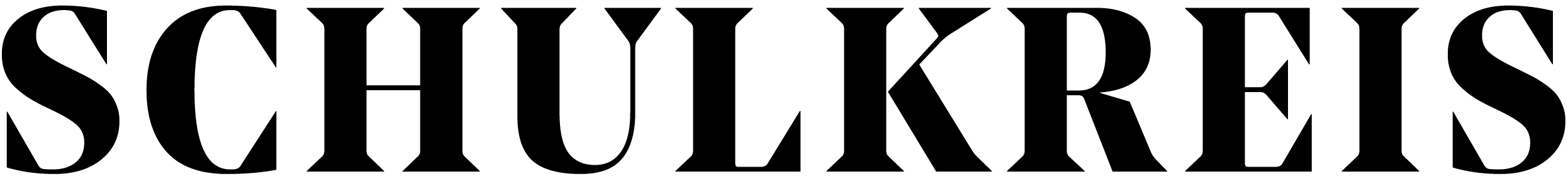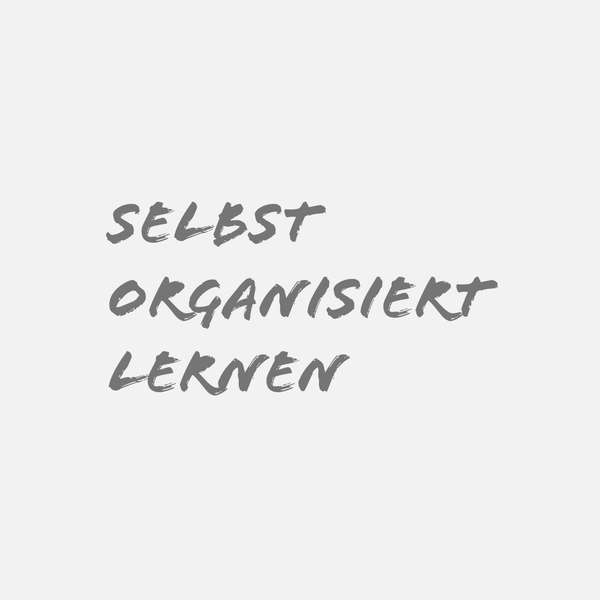Zum selbstgesteuerten Lernen in der Mittelschule
Text: Daniel Baumgartner
Die Lehrperson als Instanz für Unterrichtsregie, Choreographie, Wissensvermittlung, Klagemauer, Korrekturbüro, Bewertungs- und Zertifizierungsstelle – wo bleiben da die Schülerinnen und Schüler? Schule ist enorm lehrpersonenzentriert. Und dies auf einer Schulstufe, wo doch manche schon das Alter der Volljährigkeit erreicht haben. Wird es da nicht Zeit, einiges aus den Händen zu geben, um es aus Distanz zu begleiten und damit das Fach aller Fächer, die Individuation, zu fördern?
Was im dritten Jahrsiebt geschieht, ist der Übergang vom Aussenbewusstsein zum Innenbewusstsein. Was da angetroffen wird, ist nicht mehr so schön wie die Welt der Schmetterlinge, man fühlt sie nun im Bauch, verbunden mit Erdbeben, Wettertiefs, Klimakatastrophen, aber auch mit grandiosen Sonnenaufgängen und Höhenflügen. Dieses neue Bewusstsein ist polar konstituiert: Es schafft Selbstbewusstsein und gleichzeitig höchste Sozialsensibilität. Jugendliche gelangen über Peers zu sich selbst, spiegeln sich und handeln gegenseitig aus, wer sie jeweils sind. Das ist ein anstrengender Prozess, der im Erwachsenenleben nochmals als Forderung auftritt. Dann aber umgekehrt vom Ich zum Sozialen. Es gilt, seine Ich-Kraft aus dem Sumpf der Egoität zu holen und sein Bewusstsein so zu erweitern, dass die soziale Peripherie darin eingeschlossen ist.
Dass in der Phase vom Erwachsenden zum Erwachsenen in der Schule das Weltwissen in geballter Form vermittelt wird, mag zuweilen in Konfrontation mit den inneren Reifeprozessen geraten. Dann entstehen Stress, Müdigkeit, Unlust – mit individuellen Unterschieden. Hier kommt das Thema der Vermittlung ins Spiel und die Frage tritt auf, inwiefern das selbstorganisierte Lernen sinnvoll sein kann. Wo es eingeführt wird, verändert es die Rollen von Lehrpersonen und Lernenden sowie die Rolle der Kommunikation im Unterrichtsgeschehen – eigentlich alles.
Denken und Wille im Visier
Im regulären Unterricht steht das Gespräch im Zentrum. Es pendelt zwischen Einwegkommunikation und sokratischem Gespräch. Doch ist das Unterrichtsgespräch oft etwas überfrachtet. Es muss nicht nur stoffvermittelnd, sondern auch erklärend, motivierend und je nachdem disziplinierend sein. Die Kommunikation beim SOL wird persönlicher, individueller – und begegnungsreicher. Denn man gelangt da immer wieder an die Schnittstelle im seelischen Gefüge der Jugendlichen, wo der gute Wille als Vorsatz im Kopf den Salto mortale zur Tat im Arbeiten zu vollziehen hat. Die Wege vom Denken zum Willen und vom Willen zum Denken (es gibt auch Rückwärtssaltos) sind die Schlüsselmomente der Ich-Werdung. Sie werden in der Mitte, in Herz und Lunge, im Sympathie- und Antipathieraum, Erlebnis und bilden die Arena, in der sich Lehrende und Lernende anders begegnen. Nicht mehr im Modus der distanzierenden Belehrung, sondern im Anschub-Geben zur Selbsterkenntnis und Bewusstseinsentwicklung.
Doch sagt vielleicht manche Lehrperson: So wie ich den Stoff bringe, wirkt er seelenbildend und das lasse ich mir nicht nehmen. Dem ist zu entgegnen: Das ist wunderbar! Nun sorge dafür, dass auch andere in den Genuss deiner didaktischen Pfade kommen, auch wenn sie dich nicht kennen. Entwickle Projekte oder Pakete oder Szenarien, die die Lernenden in Eigenregie erarbeiten können. Sie haben dich dann nicht in Fleisch und Blut vor sich, aber sie treten mit deinem Geist in Kontakt. Nicht anderes funktioniert kulturelle Bildung.
Navigieren mit Niveau
Unsere Jugendlichen sind Navigationsgenies. Und Unterrichten hat viel mit Navigieren zu tun (wörtlich soviel wie die Steuerung eines Schiffes). Die Ladung dürfte dabei der Schulstoff sein, der wohlbehalten am Zielort, im Bewusstsein der Lernenden, ankommen soll. Beim selbstorganisierten Lernen übernehmen die Lernenden selbst die Navigation. Seit die sozialen Medien in die Sphäre jugendlicher Kommunikation eingedrungen sind, ist Navigieren und Kommunizieren praktisch identisch geworden. Das selbstorganisierte Lernen hebt das desolate Niveau des Navigierens, das oft ein Herumsauen in den trüben Gewässern der Emo-Kommunikation ist, auf eine Stufe, in der Denkprozesse Anwendung finden und auch gefordert werden. Da das Ich ein Willenswesen ist, das in der Selbstbezüglichkeit sich seinen eigenen Boden schafft, kann das Selbstnavigieren Reflexionsprozesse der Lernenden hervorbringen. Denn die Lernenden lernen nach und nach, das Steuer selbst in die Hand zu nehmen, was beim eher konsumistischen Frontalunterricht weniger auftritt.
Navigieren gehört zur Bewegung in offenen Gewässern. Deshalb geht es nicht um abgeschlossene Räume, sondern um die Gestaltung von Lernumgebungen, um das Fruchtbarmachen von Lernfeldern mit dem Ziel, dass sie produktiv werden, emergieren. Weltoffenheit soll in den Strukturen des Lernens Gestalt gewinnen. Es ist ein peripherer Blick, der hier zur Anwendung kommt, im Gegensatz zum zentrierten Fokus, bei dem Schule hinter Mauern und Lernen in Klassenräumen bei geschlossenen Türen stattfindet.
SOL ist kein Zauberwort, es ist die Aufforderung, die manchmal lunaren Stimmungen im Zuhörunterricht durch solare Energie aufzusprengen. Vergessen wir nicht: Die Jugendlichen sind uns immer einen Schritt voraus, ihre Patina aus der geistigen Herkunftsregion ist noch frischer als unsere. Sie werden unser Loslassen dankbar begrüssen, wenn wir es beherzt begleiten.
Zum Autor: Daniel Baumgartner hat 2018 in der FOS Freie Mittelschule den gesamten Schulbetrieb auf selbstorganisiertes Lernen umgestellt. Zusammen mit der nachfolgenden Schulleitung wurde das Konzept Jahr für Jahr weiterentwickelt und befindet sich immer noch in Entwicklung und das wird so bleiben. Denn wo gelernt und gelehrt wird, soll auch geforscht werden.